- William
Wharton
Die Nacht in den Ardennen
-
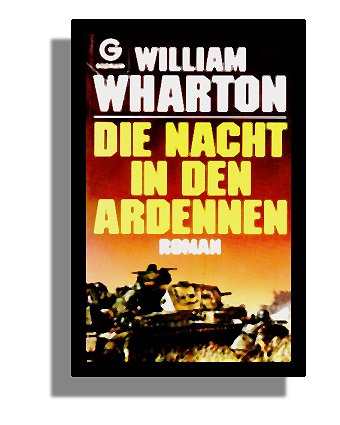
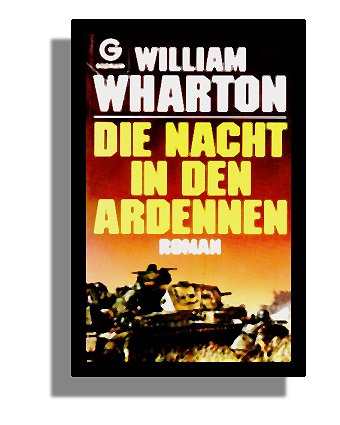
»Großer Gott, Mother! Was ist los?«
Er stößt
mich heftig gegen meine Zeltplane. Er strampelt, rudert,
rappelt
sich auf die Füße, die Stiefel knöcheltief in Morast
und
Schneematsch am Grund unserer Erdmulde versinkend. Er
ragt
über mir auf und taumelt, rutscht, sagt kein Wort;
stiert in den
Himmel.
Dann reißt er sich den Karabiner
von der Schulter, packt ihn
mit der Rechten, biegt den hageren
Kötper mit geballter Kraft
nach hinten und schleudert die
Knarre in einem langen, gewunde
nen Bogen wie einen Wurfspeer
mindestens dreißig Meter weit
den Hang hinunter. Er wirft
mit solcher Wucht, daß ihm die
Nickelbrille vom Kopf fliegt,
an meiner Brust abprallt und langsam
in Morast und Schmelzwasser
versinkt. Sie wird mit Sicherheit in
die Brüche gehen.
Er
sieht mich nicht an. Ohne Brille wirkt Mothers Gesicht leer;
er
könnte mich vermutlich gar nicht erkennen, auch wenn
er
herübersähe.
Während der vergangenen
zweieinhalb Stunden haben wir mit-
einander in dieser Kuhle auf
Posten gehockt, die möglicherweise
ein Einmannschützengraben
aus dem Ersten Weltkrieg, vermutlich
aber nur das Erdloch von
einem vermoderten, vom Wind entwur-
zeltem Baum ist.
Kaum ein
Wort ist zwischen uns gefallen. Wir sind in Vierstun-
denschichten
eingeteilt. Manchmal meine ich, Mother flennen zu
hören, aber
ich sehe lieber nicht hin; ich bin selber den Tränen so
nah,
daß ich nichts aufrühren will. Jetzt kraxelt Mother
gewehrlos
auf den Rand unseres Lochs. Er zerrt an seinem
Koppelzeug,
versucht den Haken zu öffnen.